08. Oktober
„Birklehof im Gespräch“ mit Dr. Jeromin Zettelmeyer
Es waren die intensiven, geopolitischen Diskussionen mit seinem damaligen Religionslehrer und Initiator des Sahel-Projekts, Klaus Boersch, die Dr. Jeromin Zettelmeyer dazu anregten, seinen späteren beruflichen Weg einzuschlagen. Nach dem Abitur am Birklehof im Jahr 1983 studierte er Volkswirtschaftslehre, Neuere Geschichte und Philosophie zunächst an der Universität Freiburg, erwarb den Abschluss als Diplom-Volkswirt an der Universität Bonn, und promovierte 1995 in Volkswirtschaftslehre am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

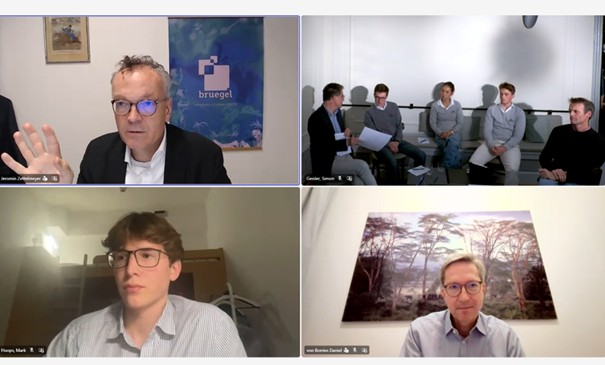

Seine Karriere begann Jeromin Zettelmeyer beim Internationalen Währungsfonds (IWF), zuletzt in der Strategie- und Politikabteilung, wo er für internationale Verschuldungsfragen zuständig war. Zu seinen weiteren beeindruckenden Stationen zählen unter anderem seine Tätigkeit als Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics in Washington, als Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium sowie als Forschungsdirektor und stellvertretender Chefökonom bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD).
Seit September 2022 leitet er den wirtschaftswissenschaftlichen Thinktank Bruegel mit Sitz in Brüssel. Seine jüngsten Arbeiten befassen sich mit dem finanzpolitischen Rahmen der EU, der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung, der wirtschaftlichen Sicherheit sowie der internationalen Klimafinanzierung. In diesem Zusammenhang entstand auch sein „Copenhagen Paper“ mit dem Titel „Geopolitical shifts and their economic impacts on Europe: Short-term risks, medium-term scenarios and policy choices.“ Die darin entwickelten Szenarien stellte Jeromin Zettelmeyer gemeinsam mit zwei Kollegen im September 2025 den Finanzministern der Europäischen Union vor – und wenige Wochen später auch den über 70 Teilnehmenden der Jubiläumsausgabe von „Birklehof im Gespräch“ am 8. Oktober 2025.
In seinem Impulsvortrag machte er deutlich, dass geopolitische Spannungen und Unsicherheiten die Weltgeschichte seit jeher begleiten – selbst in Phasen relativer Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstands, wie sie Europa und andere Demokratien seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Doch die aktuellen Entwicklungen, insbesondere seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 und der Rückkehr von Präsident Trump ins Weiße Haus, unterscheiden sich deutlich von allem, was die Nachkriegszeit bisher gesehen hat. Langfristige Trends wie der Aufstieg Chinas, das Scheitern demokratischer Reformen in Russland und die zunehmende Polarisierung westlicher Demokratien – besonders ausgeprägt in den USA – haben das Ende einer liberalen Weltordnung eingeläutet.
Welche Szenarien sind also für das Jahr 2035 denkbar – und welche erscheinen realistisch?
- Szenario 1: Eine Welt rivalisierender Nationalstaaten ohne regelbasierte Zusammenarbeit und ohne funktionierende internationale Institutionen.
- Szenario 2: Eine „Drei-Block-Welt“ mit einem US-Block, einem China-Block und einem Block nichtgebundener Staaten.
- Szenario 3: Eine starke Rolle der nichtgebundenen Staaten, begleitet von einer neuen Kompromissbereitschaft zwischen China und den USA – was zu Reformen internationaler Zusammenarbeit führt.
Allen Szenarien ist gemeinsam: Die Weltordnung bleibt multipolar. Die USA und China bleiben Rivalen, und die EU, die sich in den vergangenen Jahren als stabile und handlungsfähige Institution bewährt hat, bleibt bestehen. Für Europa geht es nun darum, Einfluss auf jene Szenarien zu nehmen, die internationale Kooperation stärken – durch mehr Resilienz und strategische Autonomie gegenüber den USA und China. Dazu gehören unter anderem ein gemeinsamer europäischer Rüstungsmarkt, bessere Rahmenbedingungen für Schlüsseltechnologien (einschließlich KI), eine Reduzierung der Importabhängigkeit von China sowie geldpolitische Innovationen wie der digitale Euro oder Refinanzierungsmöglichkeiten für regulierte Euro-Stablecoins bei der EZB.
Nach dem Impulsvortrag eröffnete Jeromin Zettelmeyer die Fragerunde. Auf Seiten des Birklehofs nahmen Schulleiter Rüdiger Hoff, Dr. Peter Itzen (Lehrer für Geschichte und Gemeinschaftskunde) sowie Simon Geisler, Anna Zhang und Arian Renda aus der Kursstufe Q2 teil. Es entwickelte sich eine angeregte und tiefgehende Diskussion: Wie lässt sich die geforderte stärkere Rolle der EU finanzieren – und ist das angesichts unterschiedlicher nationaler Finanzsysteme tragbar? Ist eine vollständige Abkopplung von Russland realistisch? Welche Möglichkeiten bestehen, den Wissenstransfer innerhalb Europas zu stärken, damit neue Ideen bessere Chancen erhalten? Und welche Anreize oder Bündnisse könnten künftig helfen, kriegerische Konflikte unattraktiv zu machen? Auch die Annäherung Russlands und Chinas und ihre Folgen für die europäische Wirtschaft wurden kritisch beleuchtet – ebenso die Frage, wie deutsche Unternehmen besser vor chinesischem Einfluss geschützt werden können.
Hätten wir uns nicht an den Zeitrahmen halten müssen, hätte diese lebhafte Diskussion sicher bis spät in die Nacht weitergehen können. Jeromin Zettelmeyer nahm sich für jede Frage Zeit und antwortete umfassend, klar und inspirierend.
Zum Schluss richtete er sich direkt an die Schülerinnen und Schüler: Europa habe eine Zukunft – und gerade die junge Generation könne dazu beitragen, die globalen Herausforderungen aktiv zu gestalten. Ein zuversichtlicher und motivierender Abschluss einer außergewöhnlich spannenden Veranstaltung.
Fotos & Text: Elisabeth Ilg

Der Birklehof 24-Stunden-Lauf siegt über Dauerregen, Kälte und Sturm – für Bildung
Beitrag lesen
Raus aus der Komfortzone – rein in die Natur
Beitrag lesenNewsletter Anmeldung
Ansprechpartner





